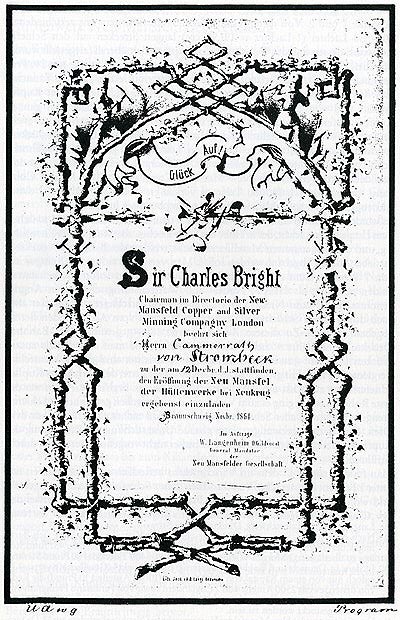|
|
Die ehemalige Kupferschiefergrube und
das ehemalige Hüttenwerk Neu-Mansfeld bei Neuekrug

Am Kiliansloch, zwischen Seesen und Neuekrug, doch noch in der Hahäuser
Gemarkung, befinden sich in der Talsohle zwischen der B 248 und der
Eisenbahnlinie einige Bodenerhöhungen, denen man ihre künstliche
Gestaltung auf den ersten Blick ansieht. Es handelt sich hier um gras- und
Gestrüpp überwachsene Stolleneingänge und Schieferhaufen als letzte
Erinnerung an den hier im vorigen Jahrhundert betriebenen
Kupferschieferbergbau. Rings um den Fuß des Harzes tritt die
Zechsteinformation auf, von Neuekrug über Wernigerode bis Ballenstedt
allerdings nur in untergeordneten einzelnen Partien, am übrigen Teil des
Gebirgsrandes jedoch ununterbrochen. Im Mansfeldischen, am Ostharz, ist
dieser Zechsteinrand am ausgedehntesten, von Sangerhausen bis Seesen aber
selten bis zu 7 km breit. Auf dem Erz führenden Glied dieser Formation,
dem Kupferschiefer, geht seit Jahrhunderten der Mansfelder Bergbau um, der
bis in die jüngste Zeit sehr günstige Resultate geliefert hat. Es kann
daher nicht verwundern, dass dadurch auch der übrige Teil der Harzer
Zechsteinbildung Gegenstand bergmännischer Unternehmungen geworden ist.
Im Jahre 1862 unternahm es der „Ober-Gerichts-Advokat" Barttlingck
aus Seesen 1), die nördliche Spitze der Zechsteinbildung
zwischen Seesen und Neuekrug bergmännisch zu erschließen. So beantragte
er bei der Herzoglichen Kammer in Braunschweig die Erteilung eines
Schürfscheines auf Kupfererze im Forstorte Gläsener im Revier Hahausen
und den angrenzenden Privatgrundstücken, welche verschiedenen Einwohnern
von Hahausen, so dem Gastwirt Rübe beim Neuenkruge, dem Kleinköter
Homann, dem Kleinköter Beitau und anderen gehörten. Es erfolgte
daraufhin im Jahre 1862 die Verleihung eines Grubenfeldes auf Silber- und
Kupfererze „bei dem Neuenkruge unweit Hahausen" unter der Benennung
„Grube Mathilde" an Barttlingck, desgleichen die eines weiteren
unter dem Namen „Grube Wilhelm".

Das an Barttlingck verliehene Grubenfeld erstreckte sich vom Kiliansloch
bis an den Langenberg, zum „Wolfsgalgen" (Bulwergalgen) bei
Hahausen, bis zur Neue und im Forstort Kl. Bakenberg in den herzoglichen
Forsten entlang der Frankfurter Straße wiederum bis zum Kiliansloch. Die
Verleihungsurkunde vom 9. Januar 1863 enthält neben anderen Auflagen auch
das Verbot von Raubbau. Doch nicht nur Barttlingck, sondern auch andere
Interessenten bemühten sich um Schürfscheine auf Kupferschiefer, so der
Fabrikant Rudolf Koch aus Goslar, dem im Jahre 1862 gleichfalls ein
solcher verliehen wurde und zwar für den Forstort Kl. Bakenberg.

Durch einige kleine Schürfschächte gelang es Barttlingck, das
Kupferschieferflöz und dessen Kupfergehalt bei Neuekrug nachzuweisen.
Dies geht aus dem „gehorsamen Bericht des Hüttengehilfen Ulrich zu Oker
über den Metallgehalt mehrerer Gruben von Kupferschiefer aus dem „Neuen
Schachte" beim Neuen Kruge unweit Seesen" vom 16. Juli 1862 an
die Herzogliche Kammer - Direktion der Bergwerke - in Braunschweig hervor.

1) Siehe „Die Barttlingcks",
S. 164 210

Chronik, Seite 210
Die Barttlingckschen Fundpunkte waren die später so
genannten Langenheim-Schächte l und 2. Von diesen Fundschächten aus fuhr
man mit verschiedenen 20 - 30 Lachter (l Lachter = 191,98 cm) langen
Strecken auf den Schiefer auf, wobei dessen und des Weissliegenden
Kupfergehalt überall festgestellt wurde. Man ließ Kupferschiefer und
Sanderz untersuchen und fand Stücke mit 2 1/2 Prozent
beim ersten und 2 Prozent Kupfer bei letzterem. Gestützt auf die
Tatsache, daß Kupferschiefer bei Neuekrug 21/2 und Weissliegendes 2
Prozent Kupfer enthält und von der Annahme ausgehend, dass dieser Gehalt
dem ganzen Kupferschieferflöz zwischen Neuekrug und Seesen innewohne,
unternahm es ein geschickter Vermittler, englische Kapitalanleger mit
diesem Funde zu beglücken. Auch Barttlingck selbst reiste 1863 nach
London. Es gelang, die erwähnten Schürfstellen mit einem Grubenfeld von
2000Morgenan eine schnell in London gebildete Aktiengesellschaft New
Mansfeld Copper and Silver Mining Company 1) für angeblich
100000 Taler zu verkaufen 2). Das Grundkapital dieser
Aktiengesellschaft soll l Million Pfund Sterling betragen haben 3).

Es
wurde nun schnell ein Plan entworfen, nach dem zunächst das Flözfeld
zwischen dem Langenheimschacht, der in Höhe des Kiliansloches, aber
westlich der Eisenbahn lag, und dem sogenannten Maschinenschacht, westlich
des Bahnhofs Neuekrug, in sieben Jahren abgebaut werden sollte. Man
versprach sich einen Reingewinn von 7 Prozent. Zum Abbau dieses
Flözstückes wurden sofort die genannten beiden Schächte als Haupt-,
Förder- und Wasserhaltungsschächte in Angriff genommen. Bis zum
Niederbringen auf den Kupferschiefer sollte dieser aber auch durch kleine
Schächte mit fallenden Strecken vom Ausgehenden herein abgebaut werden.
Zu diesem Zwecke wurde 1864 gegenüber dem Bahnhof Neuekrug eine Hütte
4) nebst „Arbeitercaserne", wie man sich damals auszudrücken
beliebte - zwei Backsteinbauten -, errichtet und durch Mansfelder
Bergleute, die man mit großen Kosten angeworben hatte, der Verhau des
Kupferschieferflözes zunächst um die Schürfschächte herum begonnen.
Kaum war der erste Rohofen fertig, ging es zum Verhütten der inzwischen
gewonnenen Schiefermengen, aber trotz aller Schmelzexperimente floss
nichts als Schlacke aus dem Ofen. So war man gezwungen, eine genaue
Untersuchung der Erzführung des Kupferschiefers, die man seltsamerweise
bisher nicht vorgenommen hatte, durchzuführen.

Man fand zunächst in dem im Verschmelzen befindlichen Schieferhaufen nur
unter l Prozent Kupfer. Das Verschmelzen dieser Schiefer wurde nun
eingestellt und wohl 200 Fuder derselben zum Planieren des Hüttenplatzes
verwendet.

1) „Chairman" der
Gesellschafter war Sir Charles Bright, „General-Mandatar" der Notar
Langenheim in Braunschweig, Direktor Howe Brown
2) Nach dem am 23. September 1863 abgeschlossenen Vertrag verpflichtete
sich Barttlingck, der Gesellschaft den Morgen Bergwerkseigentum für 300
Taler oder 45 Pfund Sterling zu überlassen, 2 Morgen Wiesen an der Bahn
für 400 Taler oder 60 Pfund Sterling.
3) In dem in Deutsch und Englisch ausgefertigten „Prospekt"
(Gesellschaftsvertrag) ist jedoch nur von einem Kapital von 100000 Pfund
(10000 Anteile ä 10 Pfund) die Rede, von denen jeweils 2500 Anteile von 2
Engländern sowie von Ferdinand Freiligrath von der Bank of Switzerland in
London gehalten wurden. Das Anfangskapital scheint jedoch später
aufgestockt worden zu sein.
4) Die „Eröffnung der Neu-Mansfelder Hüttenwerke bei Neukrug"
erfolgte am 12. Dezember 1864

Chronik, Seite 211
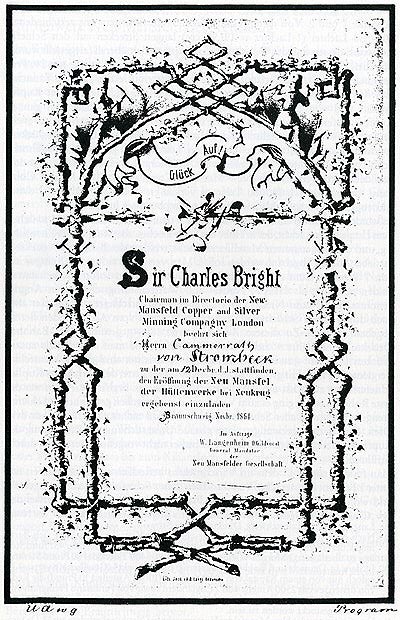
Einladung zur Eröffnung der Hütte Neu-Mansfeld
Chronik, Seite 212
Bei den in der Grube anstehenden Schiefern
fand man, dass ihr Kupfergehalt nach dem Fallen zu (in die Tiefe) sich
verbesserte, während es mit den Sanderzen umgekehrt wurde. Sollte der
Abbau des Schiefers kostendeckend sein, so musste die Mächtigkeit der
schmelzwürdigen Schiefer (bei 10 Taler Häuerlohn pro Fuder a´ 60
Zentner) 3 Zoll mit 2 Prozent Kupfer betragen, die untersten 3 Zoll
Schiefer der Schieferschachtbaue hatten aber nur 11/2
% Kupfergehalt.

Man verließ infolgedessen diese Baue und untersuchte das Flöz westlich
des, Langenheimschachtes, wo man dasselbe mit einem Stollen mit fast 2 Prozent
Kupfer anfuhr. Auf diesem Stollen und dessen Baue teufte man den
Strombeck-und den Isabeil-Schacht ab. Nachdem die guten Schiefer oberhalb
des Stollens gewonnen waren, brachte man fast gleichzeitig den Bright-
sowie den A- und B-Schacht bis auf den Schiefer nieder.

Am 18. Oktober 1864 beantragte die Neu-Mansfelder Gesellschaft einen
weiteren Schürfschein auf Kupfer- und Silbererze, Galmei und Zink, ferner
die Genehmigung zur Verwertung von Eisenstein, da man „unter dem
Zechsteine an verschiedenen Stellen auf Eisenerze" gekommen sei.
Vorläufige Untersuchungen vor den Osterköpfen über Hahausen hatten
Spuren von Erzen gezeigt, die auf Galmei und Zink schließen ließen. Die
Konzession wurde beantragt anschließend an die bisherige bis an den Fuß
der Osterköpfe, bis zum Weiler Rhode, zum Rauten-hay und zum Kiefholz in
Richtung Langelsheim. Die Verleihung ist dann auch unter dem 11. November
1864 erfolgt.

In einem Bericht aus dem Jahre 1867 1) wird der damalige
Zustand des Bergbau-und Hüttenbetriebes Neu-Mansfeld eingehend
beschrieben. Während in Alt-Mansfeld das Kupferschieferflöz sich im
allgemeinen durch regelmäßige Lagerung und flaches Fallen auszeichnet,
hat es hier ein ziemlich steiles Einfallen und wird von sehr vielen
diagonal von Ost nach West streichenden Rücken durchsetzt, die das Flöz
von etwa l m bis zu 3 Lachtern ins Liegende verwerfen. Hierdurch wurde der
Abbau der Schiefer sehr beschwerlich und kostspielig, außerdem zeigte
sich derselbe hier so arm an Kupfer, dass er nicht abbauwürdig war. Nach
ihrer Beschaffenheit sind diese Rücken meist nur offene Klüfte und
lassen die im reichsten Maße vom Harz kommenden Wasser leicht in die
Tiefe der Grubenbaue gelangen.

Die im Zechstein niedergebrachten Schieferschächte und die dazugehörigen
Abbaue waren im Jahre 1867 auflässig. Da sich aber der Schiefer in der
Tiefe sehr verbesserte, setzte man auf halber Strecke zwischen Langenheim-
und Maschinenschacht Schacht Nr. 3 an. Doch, nachdem man ihn in Kies und
tonigem Sandstein 18 Lachter tief niedergebracht hatte, musste man ihn
verlassen. Die zur Verfügung stehende Lokomobile konnte die Wasser nicht
mehr halten, außerdem zeigte sich die Zimmerung so schwach, dass der
Schacht unbefahrbar wurde. Der Strombeck- 2) und der
Isabellschacht, beide ganz im Zechstein abgeteuft,

1) Buchrucker: Der
Kupferschieferbergbau und Hüttenbetrieb zu Neu-Mansfeld bei Seesen am
Harz, In: Hüttenmännische Zeitung, Leipzig 1867
2) Benannt nach dem
Kammerrat August von Strombeck in Braunschweig, dem Verhandlungspartner
der Neu-Mansfelder Gesellschaft bei der Herzoglichen Kammer, Direktion der
Bergwerke

Chronik, Seite 213
dienten beim Abbau der Schiefer oberhalb
der Stollensohle zur Förderung und Wetterführung auch noch im Jahre
1867.

Der Bright- A- und B-Schacht, ziemlich im Streichen des Flözes stehend
und dieses fast in gleicher Teufe bei 7 Lachter treffend, durchteufte erst
2 Lachter bunten Sand und Geröll und dann den Zechstein.

Alle genannten Schächte standen in Bolzenschrotzimmerung. Der A-Schacht
war seit Sommer 1866, der B-Schacht seit Anfang des Jahres 1867 auflässig.
In letzterem stand eine 7zöllige, durch eine Lokomobile bewegte
Druckpumpe, die Förderung geschah durch einen dreimännischen Haspel. Im
Brightschachte standen zwei 7zöllige Hubpumpen, die durch eine Lokomobile
bewegt wurden. Nur in wasserreichen Zeiten arbeiteten beide Pumpen. Die
Förderung geschah durch eine Lokomobile mit 2 Zylindern und Umsteuerung.
Der Langenheimschacht Nr. l wurde 16 Lachter im losen bunten Sandstein und
2 Lachter in der Asche abgeteuft, wo er zu Bruch ging. Der gleichtiefe
Langenheimschacht Nr. 2 war seit dem Frühjahr 1866 außer Betrieb, da die
zur Verfügung stehende Lokomobile das Wasser nicht mehr halten konnte.
Durch ungeschickte Führung des Betriebes war er auch in sehr desolaten
Zustand gekommen. Zum Weiterabteufen dieses Schachtes wurde eine
horizontale Wasserhaltung von 40 PS und eine Fördermaschine mit 20 PS
aufgestellt, womit im Februar 1867 der Anfang zum Weiterabteufen des
Schachtes gemacht wurde. Der so genannte Maschinenschacht stand in starker
Bolzenschrotzimmerung, hinter welcher mit Pfosten verpfählt wurde. Zur
Wasserhaltung waren zwölfzöllige Hubpumpen eingebaut, die durch eine 40
PS starke liegende Dampfmaschine angetrieben wurden.

Oberhalb der Schächte Bright A und B waren alle abbauwürdigen Schiefer
gewonnen, ihre Grenze ging steigend bis einige Lachter oberhalb des Isabellschachtes.

Vom Brightschacht, der mit dem Strombeckschacht verbunden war, führten 50
bis 60 Lachter lange Strecken nach Westen und Osten. Zum Abbau der
Schiefer unterhalb der Brightschachtsohle wurde eine Hauptstrecke vom
Schacht aus getrieben. Seit Anfang 1867 aber war hier, wie auch im
B-Schacht, aller Abbau eingestellt. Nur noch ein cirka 36 Lachter langes
Ort sowie ein darin bei 33 Lachter angesetztes östliches und westliches
streichendes Abbauort wurden noch betrieben. Die Förderung aus dieser
Strecke nach dem Schachtfüllort geschah durch kleine eiserne Hunde,
welche durch das Schachtförderseil auf einer Schienenbahn auf- und ab
bewegt wurden.

Der Abbau des Schiefers fand in ebenso ungeregelter wie unvorteilhafter
Weise statt. Der Londoner Verwaltungsrat verlangte größtmöglichste
Schiefergewinnung und so nahm man sich keine Zeit, Abbaufelder durch
Auffahren der nötigen Strecken vorzurichten. Sobald der Schiefer mit dem
Stollen oder einem Schachte angefahren worden war, begann man das Flöz
sofort nach allen Seiten hin zu verhauen, unbekümmert darum, in welcher
Weise wohl das Legen des Strebes am besten gewesen wäre.

Der Abbau des Schiefers geschah im allgemeinen jedoch genau so wie im
Mansfeldischen. Die bergmännischen Gezähe waren die gleichen wie die in
Mansfeld

Chronik, Seite 214
gebräuchlichen. Die guten Schiefer wie auch die zum
Versatz kommenden Berge wurden in Mansfelder Räder- und Walzenhunden je
nach der Entfernung direkt an den Schacht oder in eine Hauptstrecke
gefördert und von da per Laufkarren oder Hund auf Schienen zum Schacht.

Die Gewinnung der Schiefer geschah im Gedinge (Akkord) und man bezahlte
durchschnittlich 25 - 30 Taler pro Fuder ä 60 Zentner für Hauen und aus
den Strebebauen fördern. Dies waren 10 - 11 Taler mehr als in Mansfeld
für die gleiche Leistung gezahlt wurde.

Dies war neben anderem auf die schlechte Abbauwürdigkeit der Schiefer,
die Grubenwasser, welche die Arbeiter sehr belästigten, sowie die
geringere Geschicklichkeit der eingesetzten Schieferhäuer und
Förderjungen zurückzuführen. Die zu Tage geförderten Schiefer wurden
einer Handscheidung unterworfen und dann zur Hütte gefahren, wobei auch
die Förderung der einzelnen Arbeitsgruppen gewogen und danach der Lohn
bestimmt wurde. Die Schiefer wurden dann nach Parke's Kupferprobe zweimal
untersucht. Der lebhafteste Grubenbetrieb fand im Jahre 1866 statt, in
dessen zweiter Hälfte mit cirka 110 Häuern und 45 Jungen über 420 Fuder
Schiefer gewonnen wurden. Im gleichen Jahre, am 10. 1. 1866, wurde der
Hüttendirektor, ein Engländer namens David J. Macdonald, Seesener
Bürger 1).

Das Hauptgebäude der Hütte war ebenso wie das Gebläse, Windleitung und
Winderhitzungsapparat für 3 Rohöfen eingerichtet, es waren aber 1867
erst zwei vorhanden. Der große Ofen war in der Kampagne des Jahres 1866
44 Tage in Betrieb. In dieser Zeit wurden durchgeschmolzen: 10300 Zentner
Schiefer und ca. 300 Zentner Konzentrationsschlacke, 700 Zentner Flußspat
und 2600 Zentner Koks. Zum Gebläse wurden in dieser Zeit 3000 Zentner
Braunkohlen aus Helm-stedt verbraucht. Ausgebracht wurden 600 Zentner
Rohstein mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt von 25 Prozent.

Der kleine (Mansfelder) Ofen hatte eine entsprechend niedrigere
Kapazität. Um den Rohstein, der nach England ging, anzureichern, baute
man einen Mansfelder Konzentrationsflammofen. Dieser wurde im Sommer 1866
mit in Stadeln abgeröstetem Rohstein in Betrieb gesetzt, jedoch mit
Erlangung sehr schlechter Resultate. Zu Neu-Mansfeld gehörte auch noch
eine Braunkohlengrube bei Bornhausen, außerdem die Grube „Charlesfield"
bei Münchehof.

Es kam jedoch, wie es kommen musste: Bereits im Jahre 1867 machte die
Gesellschaft ein glänzendes Fiasko. Am 17. Juli 1867 verfügte das
Amtsgericht Lutter die Zwangsvollstreckung, nachdem der „General-Mandatar"
Langenheim sein Mandat bereits am 24. Juni 1867 niedergelegt hatte.

Die Grubenfelder gingen anscheinend in den Besitz eines der
Hauptgläubiger, die Suder'schen Braunkohlen-Bergwerke in Blankenburg, die
auch die Helm-stedter Braunkohlengruben betrieben, über. Sie wurden
jedoch nicht mehr ausgebeutet. Jedoch noch am 2. August 1901 beantragte
diese Firma bei der Herzoglichen Direktion der Bergwerke die Übernahme
der Grube Mathilde.

1) Im Jahre 1864 wird der
Hüttendirektor Ing. Charles Turner aus Southampton genannt, der am 26.
Februar 1864 einen Zusatzvertrag mit Barttlingck im Hause des Gastwirts
Ferdinand Rübe auf dem Neuenkruge abschloss

Chronik, Seite 215
Am 23. 2. 1915 beantragte die Hildesheimer
Bank „seit einer Reihe von Jahren Eigentümerin des Bergwerkseigentums
an dem Grubenfeld „Mathilde" in der Gemarkung Langelsheim (?), in
dem bekanntlich Kupferschiefer ansteht", die Wiederaufnahme des
Bergbaubetriebes.

Es ist jedoch nicht mehr zur Wiederaufnahme des Betriebes gekommen und so
wurde durch Beschluss vom 5. August 1919 das Bergwerkseigentum an der
Grube Mathilde aufgehoben. Die Hüttengebäude Neu Mansfeld waren bis Ende
des 19. Jahrhunderts im Besitz der Wehrenpfennig'schen Glashütte und
gingen dann in Privatbesitz über.

Doch noch im Jahre 1925 ließ der Gutsbesitzer Otto Prien, Besitzer des
Schriftsassengutes Nr. 20 in Hahausen, beim Landesbergamt in Braunschweig
anfragen, wer für „Brüche an alten verlassenen Stollen"
verantwortlich sei. Ein solcher größerer Bruch auf dem ehemaligen
Neu-Mansfelder Gelände hätte ein Gespann des Herrn Prien in Gefahr
bringen können. Auch in den 30er Jahren entstand ein Loch durch
Stolleneinbruch in der Frankfurter Straße in Höhe des Kilianslochs.

Ansonsten ist heute von der Grube Neu-Mansfeld außer den anfangs
erwähnten Bodenerhöhungen und, wenn man so will, den ehemaligen
Hüttengebäuden, nichts mehr vorhanden. Doch hat sich die Erinnerung an
den ehemaligen Bergbaubetrieb bei den Einwohnern von Hahausen bis auf den
heutigen Tag erhalten. Daran erinnern auch die Bezeichnungen „Hütte"
und „Hüttenweg" für den aus dem ehemaligen Hüttenbetrieb
hervorgegangenen Ortsteil von Hahausen.

Chronik, Seite 216
<zurück
weiter>
|