|
|
Die Zeit zwischen den Kriegen

Die „Republik Braunschweig", wie unser Land
jetzt hieß, wurde von August Merges als Präsidenten regiert, Sepp Oerter
war Innenminister, Minna Faßhauer Kultusministrize. Es wurden neue
Landesgesetze erlassen, die für das öffentliche Leben in der Gemeinde
von Bedeutung sein sollten, so das Gesetz über die Wahlen zu den
Gemeindevertretungen vom 15. November 1918 und das Gesetz über die
Neuordnung der Volksschulaufsicht vom 12. September 1919. Mit dem
Wahlgesetz wurde endlich das leidige Dreiklassenwahlrecht abgeschafft. Im
Jahre 1919 wurde der elektrische Strom auch in Hahausen eingeführt und
1920
wurde Heinrich Dürkop zum Gemeindevorsteher gewählt.

Der verlorene Krieg hatte Kummer und Sorgen auch in Hahausen hinterlassen.
Der schlimmste Verlust waren die vielen jungen Menschen, die ihr Leben
geopfert hatten. Die Hungerblockade, die auch nach dem Ende des Krieges
aufrecht erhalten wurde, wirkte sich jedoch auf unser Dorf nicht so
negativ aus wie auf die großen Städte des Reiches, da nahezu alle
Hahäuser Selbstversorger waren. Doch die Reparationslasten lagen schwer
auf den Einwohnern. Ende März 1920 spürten die Hahäuser die
Nachwirkungen des Kapp-Putsches in Berlin. Am 13. März hatten
Freikorps-Formationen unter General Lüttwitz und die Marine-Brigade
Ehrhardt das Regierungsviertel in Berlin besetzt und der
General-Landschaftskommissar Kapp hatte sich selbst zum Reichskanzler
ernannt. Er scheiterte jedoch einige Tage später an dem ausgerufenen
Generalstreik.

Der Aufruf zu diesem Generalstreik löste im ganzen Reich Spannungen aus
- auch im Harzvorland. Erregte Demonstranten aus Rhüden und Bornhausen
griffen die Bauern auf den Feldern an und hinderten diese „Streikbrecher"
am Pflügen. In Hahausen besetzten Demonstranten die Post und zogen vor
die Häuser der Mitglieder der bewaffneten Ortswehr, wo sie die Herausgabe
der Gewehre verlangten. Diese politisch rechts stehende Ortswehr wurde als
militante Organisation zur Wiederherstellung der Vorkriegszustände
angesehen. Die Demonstranten konnten sich jedoch nur in den Besitz weniger
Gewehre setzen, da die Angehörigen der Ortswehr diese bei dem
Kommandanten der Wehr deponierten. So kam es nicht zum Blutvergießen.

Durch diese politischen Gegensätze war die Einigkeit innerhalb der
Hahäuser Bevölkerung doch sehr ins Wanken geraten. Dies zeigte sich
neben anderem auch in der im Jahre 1920 aus politischen Gründen erfolgten
Teilung des Männergesangvereins von 1873. In diesem Jahre bildete sich
aus ausgeschiedenen Mitgliedern ein Arbeiter-Gesangverein unter dem Namen
„Harmonie", dessen Vorsitzender Wilhelm Schulze und dessen Dirigent
der Lehrer Karl Henze wurde. Die Wahlen vom 16. Mai 1920 brachten im Lande
Braunschweig eine sozialistische Mehrheit im Landtag (32:28) und eine
ebensolche Regierung. Der „Freistaat Braunschweig" erhielt eine
neue Landesverfassung, die am 23. Dezember 1921
verabschiedet wurde.

Im September 1920 konnte man im „Beobachter" lesen, welche Kosten
die Einführung des elektrischen Stroms verursacht hatte:

Chronik, Seite 95

Die Anlage kostet 107.500 Mark. Davon wird der Kreis 23500
Mark übernehmen. Über die Herbeischaffung der restlichen 84.000 Mark
fanden lange Auseinandersetzungen statt, bis man sich schließlich dahin
einigte, auf jeden Anschluss 200 Mark und auf jede Brennstelle vorweg 20
Mark zu erheben, wodurch eine Summe von 34.000 Mark erzielt wird. Der Rest
soll durch Anleihe gedeckt werden. Es sind zur Zeit 120 Anschlüsse mit
ca. 700 Brennstellen und 2 Motore vorhanden.

Im März 1922 wurde von 58 Mitgliedern der Pflicht-Feuerwehr die
Freiwillige Feuerwehr gegründet und 1923 wurde Ferdinand Immenroth zum
Gemeindevorsteher gewählt.

Zu den schweren Erschütterungen, denen in der Nachkriegszeit die
Dorfgemeinschaft ausgesetzt war, zählte vor allem auch die besonders in
den Jahren 1922 und 1923 grassierende Inflation, während der schließlich
nur noch mit Millionen, Milliarden und Billionen gerechnet wurde. Firmen
und Banken gaben eigenes Geld heraus, so auch die Volksbank in Lutter.
Gleichzeitig begann die Zeit der Arbeitslosigkeit. Doch ließen sich die
Hahäuser dadurch zunächst nicht all zu sehr erschüttern. Man verstand es
noch immer, Feste zu feiern. So wurde das 50jährige Stiftungsfest des
Männergesangvereins von 1873 ganz groß begangen. Der „Beobachter"
berichtete: 50 Jahre MGV Hahausen Hahausen. Zu einem Volksfest gestaltete
sich die Feier des goldenen Jubiläums des hiesigen Männergesangvereins.
Aus dem Orte selbst und von nah und fern waren 21 Vereine anwesend. An der
Friedenseiche im Dorfe nahmen die Vereine Aufstellung. Nach einem Lied
begrüßte hier der Vereinsvorsitzende O. Deppe die Festgäste. Pastor
Gagelmann aus Lutter feierte das deutsche Lied und die Sänger mit warmen
Worten. Eine der Ehrendamen, Frl. Hedwig Taufall, überreichte in schön
gebundener Rede eine Fahnenschleife. Den noch lebenden Vereinsgründern
Karl Lowes, Heinrich Busse und Christian Warnecke wurden Ehrendiplome
überreicht. Hierauf reihten sich die Vereine zum Festzug, wie man ihn in
unserem Ort noch nicht gesehen

Chronik, Seite 96

hat. Die bunten Fahnen, die Herolde in
mittelalterlicher Tracht, der vierspännige Festwagen mit der Loreley (von
Frl. Alwine Illers dargestellt) und ihren Huldinnen, die die goldene 50
hochhielten, die Landauer mit den Gründern und Ehrenmitgliedern machten
einen imposanten Eindruck. Im Langenberge fanden sich dann die Vereine
zusammen, um unter Eichen und Buchen ihre Lieder vorzutragen. Am Abend
fand ein Tänzchen in beiden Gastwirtschaften statt. Am Montag wurden die
Schulkinder mit Musik von der Schule abgeholt und im Saale der Schlueschen
Gastwirtschaft gingen die Stunden bei Spiel und Gesang schnell vorbei.

Im Jahre 1925 hatte Hahausen nach der Volkszählung vom 16. Juni 1925 852
Einwohner, die in 221 Haushaltungen und 138 Wohngebäuden lebten, davon in
„Neuekrug, Weiler und Bahnhof' 123 Einwohner in 30 Haushaltungen und 18
Wohnhäusern.

Der Haushalt der Gemeinde für das Rechnungsjahr 1928/29 war durchaus
ausgeglichen. Er belief sich auf 20.691.10 Mark Einnahmen und 20.046.59
Mark Ausgaben, so dass ein Überschuss von 644.51 Mark verblieb. Zu den
Ausgaben zählten u. a. 9 Mark für ein Buch, das man in der Buchhandlung
„Volksfreund" gekauft hatte, sowie 4 Mark für eine Mütze für den
Gemeindediener.

Der Winter 1928/29 war besonders hart. Er schädigte mit - 32° C die
Lebewelt schwer. Im Harz erlagen 2000 Stück Rotwild der unerbittlichen
Kälte, hungergeschwächte Wildtiere und Greifvögel kamen bis in die
Dörfer, wo viele Haustiere in den Ställen erfroren. In Hahausen war fast
die gesamte Wasserleitung zugefroren, nur „am Platze" befand sich
ein offener Brunnen, von dem die Einwohner ihr Wasser holen konnten.

Wenn man dem Einwohnerverzeichnis von 1928 glauben will, dann hatte
Hahausen mit Neuekrug in diesem Jahre bereits 975 Einwohner (oder doch nur
875?), die in 251 Haushaltungen und 156 Wohngebäuden lebten. Demnach
hätte innerhalb von 3 Jahren die Einwohnerschaft um 123 Personen
zugenommen, während die Zahl der Haushalte um 30 und die der Wohngebäude
um 18 gestiegen wäre. Das bedeutete bei der Einwohnerzahl eine Steigerung
um etwa 15% und bei den Haushaltungen und Wohngebäuden von jeweils mehr
als 10% Gemeindevorsteher war nach wie vor Ferdinand Immenroth, dessen
Stellvertreter Albert Hoffmeister, Gemeindeeinnehmer K. Homann,
Schiedsmann Heinrich Pümpel. Das Amt des Standesbeamten wurde von
Ferdinand Immenroth mitverwaltet. Es gab eine Postagentur mit
öffentlicher Sprechstelle bei Wilhelm Möker. „Onkel" Möker war
im Hauptberuf Barbier, suchte seine Kunden in ihren Häusern auf und zog
auch Zähne. Neben den beiden Gesangvereinen werden die Freiwillige
Feuerwehr unter

Chronik, Seite 97

ihrem Führer Karl Immenroth, die Kriegerkameradschaft, der Landwehrverein
und der Stahlhelm (Bund der Frontsoldaten), dessen Führer der Lehrer
Richard Timmer war, erwähnt. Es gab drei Gastwirtschaften, nämlich die
von Friedrich Bode auf dem Neuen Kruge, von August Preuß und Heinrich
Schlue. Die Einwohnerschaft setzte sich aus in der Landwirtschaft tätigen
zusammen und zwar vom Gutsbesitzer bzw. Besitzer des Schriftsassengutes
über Kärrner, Vollköter und Halbköter bis zum Gespannführer und
Landarbeiter, dem Ackergehilfen, dem Schweizer, dem Knecht und der
Dienstmagd. Es gab viele Waldarbeiter und holzverarbeitende Handwerker wie
Tischler, Stellmacher und Muldenhauer, doch auch andere Handwerker wie
Bäcker und Schlachter, Schmiede, Schuhmacher, Schneider und Frisöre und
sogar einen Dekorationsmaler. Viele Hahäuser waren als Maurer oder
Bahnarbeiter beschäftigt. Es gab auch einige Bahnbeamte, Förster,
Lehrer, Hausschlachter, Kohlenhändler, Wegewärter, einen Former und
einige Arbeiter, l Molkerei und 3 Kolonialwarenhandlungen. Die Wahlen zum
braunschweigischen Landtag imjahre 1930 ergaben ein Kabinett aus
Deutsch-Nationalen und Nationalsozialisten.

Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre verschärften sich die
politischen Gegensätze zwischen den meist eng miteinander verwandten
Einwohnern von Hahausen immer mehr. Standen sich in den ersten Jahren nach
dem Kriege vor allem der Stahlhelm bzw. die Deutsch-Nationalen auf der
rechten und die Sozialdemokraten auf der linken Seite gegenüber, so waren
es jetzt mehr und mehr Anhänger der NSDAP und der SPD, die sich konträr
gegenübertraten.

Bis Anfang 1931 gehörten dem Gemeinderat an: Carl Heche, Wilhelm
Immenroth, Wilhelm Ohlendorf, August Preuß, Fritz Rollwage, Gustav
Rühmann und Heinrich Sommer. Gemeindevorsteher war auch weiterhin
Ferdinand Immenroth.

Am 08. Januar 1931 wurde ein
Wahlausschuß für die Kommunalwahlen gebildet und der Arbeiter Otto
Schmidt zum Sammler für die Landesspende gewählt. Im Januar 1931
beschloss der Gemeinderat „zur Verbesserung bzw. Neuanlage einer
Kläranlage in der Neuekruger Wasserleitung" Kostenanschläge
einzuholen, im Februar ging es um die Notstandsbeschäftigung von
Arbeitslosen. Am 13. 3. 1931 konstituierte sich der neu gewählte
Gemeinderat. Ihm gehörten an: Carl Beitau, Carl Illers, Wilhelm Immenroth,
Karl Kalbreier, August Preuß, Fritz Rollwage, Heinrich Sommer und Carl
Süßschlaf. Gemeindevorsteher wurde wiederum Ferdinand Immenroth, zum
Vorstehergehilfen wurde Wilhelm Immenroth gewählt.

Am 25. 3. 1931 wurde das Gehalt des Vorstehers von 1150.-- Mark jährlich
auf 1000.— Mark herabgesetzt, entsprechend das des Steuereinnehmers.
Ferner wurde beschlossen, „Zum Aushilfsdienst für den erkrankten
Gemeindediener Hoffmeister soll Jakob Gefäller bestellt werden. Für die
Nachtwache und Gemeindedienst erhält der Letztere eine wöchentliche
Vergütung von 12 Mark." Am 2. Juni 1931 wurde ein Antrag auf
finanziellen Zuschuss für die Schule wegen der schlechten Finanzlage
abgelehnt. Die Gemeinde hatte bereits die Kopf- und Biersteuer
eingeführt, um den Haushaltsplan auszugleichen.

Chronik, Seite 98
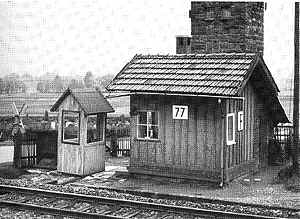

Bahnwärterhaus

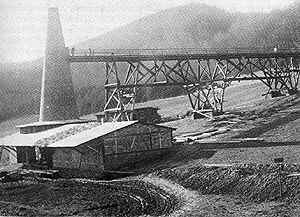

Priens Kalkofen
Chronik, Seite 99

Am 1. Juli 1931 wurde für den inzwischen
verstorbenen Gemeindediener Fritz Hoffmeister von 5 Bewerbern Otto Schmidt
als Gemeindediener und Nachtwächter gewählt. Er erhielt ein monatliches
Gehalt von 60,— Mark und freie Wohnung.

Am 26.10. 1931 verhandelte der Gemeinderat über die Trennung des
Opferei - Vermögens von der Schule. Es wurde beschlossen, dass den
Verpflichtungen, die der Gemeinde aus dem Vertrag von 1919 zwischen Kirche
und Schule entstanden waren, nachgekommen werden solle.
Auch noch 13 Jahre nach Kriegsende hatte die Gemeinde unter dem verlorenen
Kriege zu leiden. In den Jahren 1917/18 waren Kriegsanleihen gezeichnet
worden, für die bei der Volksbank Lutter ein Darlehn in Höhe von 26.933,—
Mark aufgenommen worden war. Jetzt erhob die Volksbank
Aufwertungsansprüche. Nach vielem Hin und Her konnte man sich jedoch auch
in dieser Angelegenheit einigen.
Am 05. Januar 1932 beschloss
der Gemeinderat über die Verteilung der von der „Nothilfe"
gesammelten Lebensmittel an bedürftige Gemeindemitglieder. Das
Haushaltsjahr 1931/32 erbrachte 17.746.71 RM an Einnahmen und 17.391.27 RM
an Ausgaben, sodass ein Überschuss von 355.44 RM erwirtschaftet werden
konnte. Die Kosten waren an Gehältern und Löhnen 1045.— RM für den
Gemeindevorsteher, 666.— RM für den Gemeindeeinnehmer, 726.— RM für
den Gemeindediener und 174.— RM für den Standesbeamten. Weitere
Ausgaben waren u. a. ein Zuschuss zur Schulkasse in Höhe von 2.000,54 RM
und für Wohlfahrtspflege von 5.773.30 RM sowie ein Posten „An Preuß
für Unterbringung der Obdachlosen gezahlt".

Im Jahre 1932 gab es in Hahausen auch einen sogenannten „Ordnungsdienst"
bzw. eine „Ordnungsmannschaft", deren Führer Albert Dürkop war.
Anfang 1932 wandte sich die Kreisdirektion Gandersheim in einem Schreiben
an den Gemeinderat, in dem die Bildung eines „Luftschutz-Beirats"
gefordert wurde. Seit Mitte 1932 war Heinrich Sandvoß an Stelle von
August Preuß Mitglied des Gerneinderates.

Die Gegensätze zwischen den Anhängern der SPD, der „Eisernen
Front" bzw. des „Reichsbanners" auf der einen und der NSDAP,
insbesondere der SA, auf der anderen Seite, nahmen immer radikalere Formen
an. In Hahausen gab es Schlägereien auf offener Straße zwischen Nachbarn
aus politischer Gegensätzlichkeit, nahe Verwandte entzweiten sich. Die
Uniformen von SA und Reichsbanner beherrschten die Straßen, zumal die
vielen Arbeitslosen in der vielen freien Zeit Konfrontationen suchten.
Uniformierte Kommunisten gab es in Hahausen kaum, doch erschienen solche
aus den Nachbargemeinden wiederholt im Orte.

Am 19. 8.1932 stellte die Ortsgruppe der NSDAP Hahausen einen Antrag auf
Auflösung des Gemeinderates. Dieser Antrag wurde wegen „nicht richtiger
Unterschrift" zurückgewiesen. Daraufhin stellten zwei
Gemeindevertreter einen Antrag auf Auflösung des Gemeinderates, über den
am 2. 9.1932 abgestimmt wurde. Ergebnis: 4 Ja-Stimmen, 4 Nein- Stimmen, l
ungültige Stimme. Der Haushaltsplan für 1932 schloss mit einem
Fehlbetrag von 4.600.— RM.

Chronik, Seite 100

Am 4. Januar 1933 beschloss der Gemeinderat daher, bei der Staatsbank in
Seesen eine Anleihe von 1000.— Mark aufzunehmen.

Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933
änderte sich auch in Hahausen manches. Zunächst wurde eine aus
ortsansässigen SA-Leuten gebildete Hilfspolizei
aufgestellt. Sie wurde jedoch bald wieder aufgelöst.

Der Gemeinderat blieb vorerst bestehen, doch verlor der Gemeindevorsteher
Ferdinand Immenroth sein Amt. Kommissarischer Gemeindevorsteher wurde
William Busse.

Am 22. 3. 1933 wurde der (noch bestehende) Antrag der NSDAP auf Auflösung
des Gemeinderates zurückgezogen. „Es wurde sodann von drei
Gemeinderatsmitgliedern ein Dringlichkeitsantrag um Auflösung des
Gemeinderates gestellt, dem Antrag wurde von den anwesenden Mitgliedern
einstimmig zugestimmt".

Am 4. Mai 1933 trat der neue Gemeinderat zusammen. Ihm gehörten an: Als
Stellvertreter des Gemeindevorstehers Wilhelm Märten, und als
Ratsmitglieder Heinrich Hoffmeister, August Kaibrei er, Wilhelm
Kalthammer, Wilhelm Klauenberg, Karl Oppermann, Heinrich Sandvoß und Otto
Taufall. Dieser Gemeinderat blieb im wesentlichen bis zum Jahre 1945
bestehen. William Busse zeichnete zunächst als „Der Beauftragte zur
Wahrnehmung der Obliegenheiten des Gemeindevorstehers".

Nachdem alle politischen Parteien und Verbände mit Ausnahme der NSDAP und
ihrer Gliederungen verboten waren, erfolgte auch die „Gleichschaltung"
in Hahausen. Die NSDAP und die ihr angeschlossenen Organisationen hatten
nach dem 30. Januar 1933 in Hahausen einen ungeheuren Zulauf zu
verzeichnen. Sei es nun aus Überzeugung, Opportunismus, Berechnung oder
unter Druck, jedenfalls traten nach diesem Zeitpunkt noch viele Einwohner
der NSDAP bei. Bemerkenswert ist, dass sich die beiden Gesangvereine 1933
wieder zusammenschlössen.

Ein Ereignis muss noch erwähnt werden, das für Unruhe im Dorfe sorgte:
Am 27. März 1933 wurden von SA-Leuten, die aus Seesen und von SS-Leuten,
die aus Braunschweig nach Hahausen gekommen waren, bei linksgerichteten
Einwohnern, vor allem bei Anhängern der SPD, Hausdurchsuchungen
durchgeführt. Bei den anschließenden Verhören im Gasthof „Zur
Deutschen Eiche" wurde ein Einwohner geschlagen. Diese Aktionen
führten bei den Betroffenen zu großer Erbitterung.

Am 18. Mai 1933 wurde der Gemeinde von dem neuen Gemeindeeinnehmer
Heinrich Sandvoß als Sicherheit „3000 Mark Erbmasse" überwiesen.
Zum Zwecke der Arbeitsbeschaffung nahm die Gemeinde einen Kredit auf.
Notstandsarbeiten in der Mergelkuhle und Regulierung der Gemeindegewässer
wurden beschlossen.

Am 2. 11. 1933 wurde der SA-Mann Hermann Poske (gefallen im 2. Weltkrieg)
als Notstandsarbeiter eingestellt. Er erhielt 2.50 Mark pro Tag abzüglich
der Soziallasten. Arn 30. 11. 1933 trat die Gemeinde der Gesellschaft zur
Vorbereitung der

Chronik, Seite 101

Reichsautobahnen bei, während am 1. Februar 1934 beschlossen wurde, die
Volksbank Lutter in der Angelegenheit der Kriegsanleihe zu verklagen. Es
kam dann jedoch zu einem Vergleich. Am 10. Dezember 1933 war bereits
beschlossen worden, zur Abfindung der Kirche (wohl aus Opfereivermögen)
einen Kredit bei der Gemeinde-Haftpflicht- und Unfallversicherung
aufzunehmen. Ferner wurde beschlossen, die beiden Wasserleitungen zur
Begegnung der Feuersgefahr miteinander zu verbinden.

1934 wurden die Waldarbeiterhäuser in Neuekrug gebaut, 1935 überließ
der Bauer Heinrich Faber die ihm gehörende Rosenstraße der Gemeinde als
Schenkung. Zu den Ausbauarbeiten, welche die Gemeinde an der Straße
ausführen ließ, zahlte Faber noch 1000.— RM hinzu.

1935 wurden anlässlich der Volksabstimmung im Saargebiet Kinder aus dem
Saarland bei Hahäuser Familien untergebracht. Am 18. Februar 1936 wurde
die Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister, wie der
Gemeindevorsteher seit 1935 genannt wurde, festgesetzt. Sie betrug 1.—
RM pro Einwohner, der Kassenführer erhielt die Hälfte.

Am 1.4.1936 wurde der neue Standesbeamte Otto Rühmann vereidigt, während
am 26.1.1937 der Neubau der Schule beschlossen wurde. 1938 plante man eine
Badeanstalt auf Taufalls Wiese vor dem Bakenberge. Der Gemeinderat beschloss,
zu diesem Zwecke Verhandlungen mit Taufall aufzunehmen. Im gleichen Jahre
wurden Teile der Forstgemarkung Langelsheim in die Feldgemarkung Hahausen
übernommen, während am 15.2.1939 auf Antrag des Landratsamts Gandersheim
beschlossen wurde, den „Kreis-Gemeinde-Steinbruch", Pächter
Gebrüder Gerber, in die Gemarkung Hahausen einzugemeinden. Im März 1939
erscheint in den Akten neben den Ratsmitgliedern und dem Beigeordneten
Wilhelm Märten auch der Beigeordnete Richard Lowes.

Die politische Lage spitzte sich immer mehr zu. In Hahausen erschienen
Flüchtlinge aus dem Sudetenland bzw. aus den deutschen Sprachinseln in
den Karpaten, die dem tschechischen Militärdienst entgehen wollten. Sie
leben noch heute in der Gemeinde.

Chronik, Seite 102
<zurück
weiter>
|